Wie sich unentschiedene Männer vor der Liebe drücken

Was seufzen Frauen in London nach einem missglückten Date? „Der Typ war total Nathaniel P.“ Was sie damit meinen? Einen Bestseller über den modernen Mann: supernett, supercool und emotional superfaul.
Man muss jetzt gar nicht autobiografisch werden, schließlich hat Adelle Waldman das auch nicht gemacht. Es fühlt sich trotzdem komisch an, wenn man ihr Buch „Das Liebesleben des Nathaniel P.“ im Zug liest, auf Berlin zubrausend, wo abends René Polleschs neues Stück „Keiner findet sich schön“ Premiere hat. Und wenn man später in einer Bar um die Ecke der Volksbühne steht, Kölsch trinkt und mit befreundeten Schriftstellern und Feuilletonisten redet. Und schließlich nach Hause geht. Man ist dann nämlich sehr verwirrt, weil alle drei Welten, das Buch, das Theaterstück und die Bar, ineinander verschwimmen.
Das müsste vielen Lesern eigentlich anders gehen. Immerhin ist nicht jeder in seinen Dreißigern und lebt vom Schreiben. Offenbar macht das aber keinen Unterschied. Denn Waldmans Roman hat sich im englischen Sprachraum nicht einfach nur wahnsinnig gut verkauft, sondern ist sprichwörtlich geworden. „Der Typ war total Nathaniel P.“, lästern junge Bankerinnen in London angeblich, wenn sie ihren Freundinnen von einem verunglückten Date erzählen. Das Phänomen scheint so allgegenwärtig, dass ihm der „Observer“ in einem langen Artikel nachgeht.
Wir suchen doch eigentlich nur die Liebe, oder nicht?
Bei René Pollesch hat der Schauspieler Fabian Hinrichs gerufen: „Entweder man geht zu einem Iggy-Pop-Konzert oder man geht nicht und sieht sich zu Hause den Film ‚Robocop‘ an. Dann klingelt es an der Tür, und eine alte Bekannte steht davor. Entweder verliebt man sich sofort in sie oder man redet und kippt zwei Stunden Rotwein in sich hinein. Und verabschiedet sich nüchtern.“ Und dann ist man auf Tinder oder Parship.de, oder man trifft auf dem Iggy-Pop-Konzert eine 20-Jährige, der man vorflunkert, man sei viel jünger.
Und wenn man nach drei Monaten Dating einen Ausflug mit einem gemieteten Auto macht, fällt einem ihr Führerschein in die Hände, und man sieht, dass auch sie sich viel jünger gemacht hat, als sie ist. Und dann trennt man sich, oder man bleibt zusammen. Das geht ewig so weiter, in einem mäandernden Mahlstrom der Unentschlossenheit. Das Leben verzweigt sich vor einem zu einem gigantischen Baum aus Möglichkeiten. Und wir suchen doch eigentlich nur die Liebe, oder nicht?

Nathaniel Piven ist auch so ein Exponent eines zaudernden Zeitgeists, Fabian Hinrichs’ Bruder in Brooklyn. Und Brooklyn ist ja auch nur eine andere Möglichkeitsform von Berlin oder London oder weiß der Kuckuck, wo – Smartphone-Country, Wireless-Lan-Town, Flat-White-Coffee-Land.
Ein junger Typ aus einer Einwandererfamilie (geschenkt), in der Schule ein halber Außenseiter (sympathisch), belesen (natürlich), Harvard-studiert (nix Besonderes mehr). Er spaziert zwischen Park Slope und Prospect Park herum, isst auswärts BioBurger und zu Hause, in seiner verwahrlosten Bude, Tiefkühlpizza. Alle paar Monate ringt er sich durch, eine mexikanische Putzfrau zu bestellen, wenn der Gestank sein schlechtes Gewissen übersteigt, auf illegale Billigarbeiter zurückzugreifen.
Überhaupt ist das Gewissen sein größter Schatz. Für knauserige Literaturzeitschriften schreibt er Essays über „die Privilegien unseres elitären Lebens, den Akt der Ausbeutung outzusourcen“. Auf von Exfreundinnen gehosteten Dinnerpartys wetzen hoffnungsvolle Nachwuchsautoren ihren Scharfsinn aneinander: „Also, was ist denn nun der Unterschied zwischen Rassialismus und Rassismus?“
Wer nicht stören will, will auch nicht gestört werden. Und sich schon gar nicht auf jemanden einlassen
Bevor der interessierte Leser Aufschluss erhält – „Rassialismus bedeutet nicht unbedingt eine ablehnende Haltung oder Vorurteile gegenüber einer Gruppe, sondern die …“ –, quatscht schon wieder einer dazwischen: „He, Leute, ratet mal, wer vierhunderttausend Dollar Vorschuss auf einen Buchvertrag kassiert hat?“ Da ist sogar Nathaniel neidisch, denn er hat soeben erheblich weniger eingeheimst, aber immerhin auch eine sechsstellige Summe.
Diese gut budgetierten Bohemiens pendeln zwischen Rucola-Pizza in Restaurants mit pseudoantiken Hellebarden an den Rohputzwänden und Lesungen in Lower Manhattan, wo sich romantisch gestimmte Zyniker um die hübschesten Lektorinnen balgen. Nathaniel lässt seine, eine hübsche Dunkelhaarige, sausen, der Smalltalk kam nicht so richtig vom Fleck.
Zuweilen hat er Mühe, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Dann gehen ihm solche Gedanken durch den Kopf: „Er wusste, dass er eine unausgesprochene Regel der Dinnerparty-Etikette brach. Die Konversation sollte ornamental sein, leicht und unterhaltsam. Niemandem sollte der Inhalt dessen, was er sagte, wirklich am Herzen liegen, es ging bloß um den Ton. Aber im Augenblick war ihm das egal.“
Glück? Geht am besten alleine
Ist ein Mensch, der Konventionen ignoriert und in Kauf nimmt, andere vor den Kopf zu stoßen, brutal und hartherzig? Oder handelt er vorbildlich, weil die Konvention selbst fragwürdig ist, ein hohles Ideal, das endlich abgeschafft gehört?
In solchen Momenten wird klar, was den Roman über eine beliebige Sitcom oder flott zusammengebastelte Chick-Lit erhebt. Die Struktur mag wenig originell sein – mit Kapiteln als hart geschnittenen Szenen, einer Erzählperspektive, die dicht an der Wahrnehmung der Hauptfigur bleibt, einem konservativ komponierten Wechsel zwischen Beschreibungen und Dialogen und einer unauffälligen Sprache.
Das Entscheidende ist der Inhalt und die Haltung der Autorin dazu. Waldman hat den Sittenroman einer sittenlosen Welt geschrieben. Seit Jane Austens oder Edith Whartons Zeiten ist, noch einmal hundert Jahre später, eine einzige Übereinkunft geblieben: Du sollst nicht verletzen, nicht mal stören. Was auf den ersten Blick wie ein Altruismus aussieht, könnte mit demselben Recht das Gegenteil sein. Denn wer nicht stören will, will auch nicht gestört werden. Und sich schon gar nicht auf jemanden einlassen.
„Ich will nicht meinen Weg“, ruft Hinrichs in der Volksbühne am Ende, „ich will deinen Weg!“ Und dreht Sinatras „New York, New York“ um: „Ich will in einer Stadt leben, die schläft. Wenn ich es hier nicht schaffe, schaffe ich es nirgends. Es liegt nicht an dir, Schweinfurt, Schweinfurt!“ So weit ist Nathaniel noch lange nicht. Er lebt in New York die ultraliberale Variante des amerikanischen Traums, die das Streben nach dem eigenen Glück so hoch schätzt, dass die Vorstellung schwerfällt, es könne sich je mit dem eines anderen vereinen. Einer Exfreundin verweigert Nathaniel nächtliche Umarmungen mit der Rechtfertigung, sie wäre ansonsten in Zukunft noch einsamer.
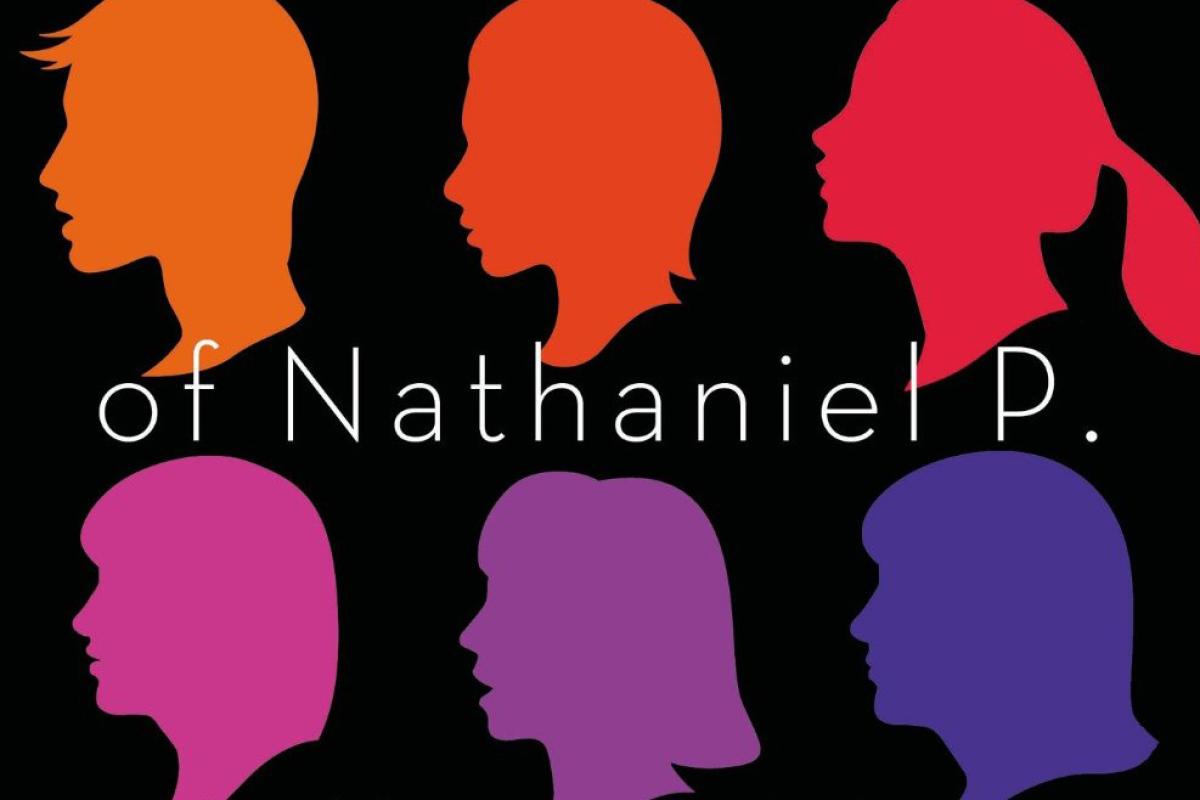
In den Genuss dieser hehren Ethik, die von Kaltherzigkeit nicht zu unterscheiden ist, kommt bald Hannah, eine Bekannte der Ex-Freundin. „Nate hatte seine ablehnende Haltung zu Beziehungen nicht direkt aufgegeben“, schreibt Waldman mit hintersinnigem Spott. Aber für den Moment macht es mit der lässig-selbstbewussten Hannah doch zu viel Spaß, und ihre Brüste sind zu schön. Da steigert man sich schon mal in die Illusion hinein, man sei verliebt. Und ist denn Liebe jemals etwas anderes als eine Selbsthypnose, aus der man sich nicht mehr aufzuwachen entschließt?
Nur ist Nathaniel eben weder ein ruhiger Schläfer noch besonders entschlussfreudig. So sickert sein altes Selbst hartnäckig durch den frisch gegossenen Beziehungsbeton, bis mit Hannah auch der optimistischste Statiker das Weite sucht. Der Roman verzeichnet die Stationen dieses allmählichen Zusammenbruchs.
Man muss gar nicht zu viel aus dem Umstand machen, dass Waldman eine Frau ist, die das Porträt des zeitgenössischen Mannes zeichnet. Interessanter ist, wie sie es tut. Nämlich eben nicht einseitig, ungerecht, womöglich aus Rachsucht. Sondern in dieser seltsamen Schwebe, die, ebenso wie die Zeit, die sie beschreibt, vor der Entscheidung zurückschreckt, Verantwortung, gar Schuld zuzuweisen. Aber was für die Zeit ein Problem sein mag, ist für den Schriftsteller – da hat sich seit Jane Austen nichts geändert – eine Tugend.
