THEMEN DER ZEIT
Perinatalerhebung: „Mutter“ der QS-Maßnahmen
;
Die öffentliche Diskussion vermittelt mitunter den Eindruck, Ärzte und Kliniken störe das Prinzip Qualität. Das ist falsch: Die Ärzteschaft selbst hat die externe vergleichende Qualitätssicherung in der Medizin vor rund 40 Jahren eingeführt.
Die Mutter aller datengestützten Qualitätssicherungsmaßnahmen ist die Bayrische Perinatalerhebung. Am Beginn vor fast 4 Jahrzehnten stand ein Vorwurf. Nach den damaligen Statistiken war die perinatale Mortalität im Raum München höher als in anderen deutschen Regionen. Die Reaktion der Münchner Frauenärzte war revolutionär: sie entschlossen sich, die eigene Qualität zu dokumentieren. So wurde die Münchner Perinatalstudie geboren.
Bereits seit Mitte der 60er-Jahre tauschten die Münchner Kinderkliniken Statistiken über die ihnen zugewiesenen Neugeborenen aus. Dabei zeigte sich, dass Erfolge oder Misserfolge ohne Kenntnis detaillierter Daten aus Schwangerschaft und Geburt nicht interpretierbar waren. Deshalb etablierten 1970 Pädiater und Geburtshelfer aus dem Großraum München die „Perinatologische Arbeitsgemeinschaft München“ unter der Federführung des Berufsverbandes der Frauenärzte. Sie sammelte perinatologische Daten als Basis für wissenschaftliche Auswertungen und Maßnahmen der Qualitätssicherung. Zur Erfassung der kranken Neugeborenen wurde 1972–1973 ein datenverarbeitungsgerechter Erhebungsbogen entworfen.
Am 1. Januar 1975 begann die „Münchner Perinatalstudie“. Beteiligt waren 26 Frauenkliniken und 7 Kinderkliniken unterschiedlicher Größe und Struktur in München und Umgebung und das Marienkrankenhaus Amberg in der Oberpfalz. Die Finanzierung erfolgte bis 1977 durch das „Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung“, die KVB stellte kostenlos ihre EDV zur Verfügung. Mitte 1976 übernahm das Institut für Medizinische Informationsverarbeitung der LMU München die Auswertung des Datenmaterials. 1977 beauftragte der Bayerische Ärztetag den Vorstand der BLAEK, die Münchner Perinatalstudie auf ganz Bayern auszudehnen.
Folgende Prinzipien zeichneten die „Bayerische Perinatalerhebung“ aus:
- Sie ging von den Ärzten in Niederlassung und Klinik und den Vertretern des Berufsverbandes der Frauenärzte aus
- Sie bezog die Pädiater mit ein, die damals ganz allgemein in Deutschland keinen Zugang zu den Kreißsälen hatten
- Freiwillige Teilnahme
- Vertraulichkeit
- Anonymität der teilnehmenden Klinik und der Patientin/des Kindes
- Simultane Erfassung aller Geburten einer Klinik
- Erstellung von klinikbezogenen und problemspezifischen Perinatalstatistiken
- Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer beim Ziehen von Schlussfolgerungen.
Ehrlichkeit bei der Dokumentation und Vertraulichkeit bei der Datenverarbeitung und im Dialog ermöglichten die Identifikation von Qualitätsmerkmalen und -indikatoren, Standortbestimmung, Benchmarking und Identifikation von Verbesserungspotenzialen. Formulierung von Qualitätszielen und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung waren die Werkzeuge in diesem steten Dialog der Geburtshelfer und der Kinderärzte. Nicht „Anprangern“ und Schuldzuweisung war die Philosophie, sondern interkollegiale Kommunikation und Unterstützung mit dem Ziel einer flächendeckenden Qualitätsverbesserung. Schwangere sollten darauf vertrauen können, dass in der von Ihnen aufgesuchten geburtshilflichen Abteilung ein hoher Qualitätsstandard vorgehalten wird.
Internationale Spitzenstellung
Dieses Beispiel machte Schule. Im Großraum Hannover begannen 1980 dann 15 geburtshilfliche und 4 pädiatrische Abteilungen mit einer Perinatal- und Neonatalstudie nach bayerischem Muster. Ab 1983 ging diese in die niedersächsische Perinatalerhebung über, ein Zwilling des bayerischen Modells.
In den Jahren danach folgten alle alten Bundesländer, außerdem Finnland und Südtirol. Datenerfassung und -auswertung entsprachen dem bayerisch-niedersächsischen Muster und sicherten die Vergleichbarkeit der Daten. Die Träger waren unterschiedlich, die Ärztekammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, beide zusammen und vereinzelt auch die Krankenhausgesellschaften und Krankenkassen. Die freiwillig entstandenen und dezentral arbeitenden Perinatalerhebungen der Länder erfassten ca. 96 % aller Schwangerschaften und Geburten.
Nach der Wiedervereinigung schlossen sich die neuen Bundesländer an. Was als Münchner Perinatalstudie begann, ist somit die älteste datengestützte Qualitätssicherungsmaßnahme Deutschlands.
Mütterliche und kindliche Morbidität und Mortalität verbesserten sich. Deutschland stieg in den folgenden Jahrzehnten in die internationale Spitzengruppe auf.
In den 90er-Jahren übernahmen Politik und Gesetzgeber. Dies kann als Anerkennung für die Zweckmäßigkeit der von der Ärzteschaft initiierten Qualitätssicherungs- und -verbesserungsmaßnahmen verstanden werden. 1989 wurde in den §§ 137 und 112 Sozialgesetzbuch V die Teilnahme an der externen Qualitätssicherung für den stationären Bereich verpflichtend.
Mit der Akzeptanz durch den Gesetzgeber gab es aber zunehmend gravierende Einschnitte in das ursprüngliche System der Qualitätssicherung. In immer schnellerer Folge regulierten neue Gesetze das Gesundheitswesen und beeinflussten auch die externe Qualitätssicherung
In Ausführung der Vorschriften des SGB V zur Sicherung der Qualität von Krankenhausleistungen bei Fallpauschalen und Sonderentgelten schlossen die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherer am 2. August 1994 einen 2-seitigen Vertrag. Diejenigen, welche die Qualität erbringen sollten, wurden dabei ausgeschlossen; die Bundesärztekammer und die Berufsorganisationen der Krankenpflegeberufe wurden im neu geschaffenen Bundeskuratorium lediglich „beratend“ zugezogen.
In Bayern dagegen wurde im April 1995 ein dreiseitiger paritätischer Vertrag zwischen Krankenkassen, Landeskrankenhausgesellschaft und Landesärztekammer abgeschlossen und die Bayerische Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der stationären Versorgung (BAQ) gegründet.
Im 2. GKV-Neuordnungsgesetz von 1997 wurde auch auf Bundesebene die Bundesärztekammer als 3. Vertragspartner in den Rahmenvertrag einbezogen.
Während die BAQ wie auch die anderen Landesgeschäftsstellen der Qualitätssicherung eine Konstante waren, wechselten die Akteure auf Bundesebene mehrfach. Erst SQS, dann BQS, AQUA und jetzt das neu geschaffene IQTIG.
Zur Verbesserung der Transparenz und der Patientenrechte wurde die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse der externen Qualitätssicherung eingeführt. Und mit dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetz sollen die Daten der Qualitätssicherung gleichzeitig auch für die Krankenhausplanung dienen.
Kein Werbemittel
Transparenz für die Patienten und gute Krankenhausplanung sind nötig. Ist es aber sinnvoll, dafür die gleichen Instrumente zu nutzen, welche für die Qualitätssicherung gebraucht werden? Kann dieses Werkzeug so unterschiedliche Aufgaben wie Qualitätssicherung, Klinikvergleich und Krankenhausplanung erfüllen?
Parameter, die unter der Prämisse der Vertraulichkeit erhoben wurden und sich im interkollegialen Dialog bewährt hatten, werden nun umfunktioniert zu „Kliniknavigatoren“ zur Identifikation des besseren oder schlechteren Krankenhauses. Sie wurden vom Instrument der Qualitätsverbesserung zum Werbetool im Wettbewerb um den „Kunden“.
Qualitätsverbesserung ist darauf angewiesen, dass Fehlerquellen und Schwächen gesucht werden, um sie künftig zu vermeiden. Eigendarstellung mit dem Ziel der Kundenwerbung macht das Gegenteil: Herausstellung von Stärken und Verschweigen von Schwächen. Nicht Qualitätsverbesserung ist hier das Ziel, sondern Verbesserung des Images. Und davon hängt die wirtschaftliche Basis der Klinik ab. Das im Rahmen der Qualitätsverbesserung gewünschte Aufzeigen von Mängeln und Schwachstellen gefährdet direkt den wirtschaftlichen Erfolg, während das Verdecken von Verbesserungspotenzialen ihn zumindest kurzfristig fördert.
Für manche Geschäftsführer von Kliniken scheint dieses Instrument verlockend als Werbemittel im Wettbewerb untereinander: „Wer alle Ergebnisse publiziert, hat nichts zu verbergen“. Was unternimmt wohl der an Offenheit und Transparenz so interessierte Geschäftsführer, wenn die Zahlen der Qualitätssicherung Mängel in seinem Haus aufweisen? Er wird vermutlich den Chefarzt anweisen, dafür zu sorgen, dass die Zahlen künftig stimmen. Das ist auf zwei Wegen möglich. Der richtige ist steinig und kostet eventuell sogar Geld.
Wirtschaftlicher Druck wird von der Geschäftsführung unmittelbar an die Ärzteschaft weitergegeben. Welche Auswirkungen mag dies auf die Zielsetzung bei der Qualitätsdokumentation und auf ihren Wert zur Qualitätsverbesserung haben?
Die sogenannte Transparenz unterstützt auch die Modeerscheinung des Rankings; das Bilden von Ranglisten der Krankenhäuser, welches die beste Geburtshilfe hat, am besten die Galle entfernt oder Brustkrebs behandelt. Was stört daran? Anspruch der Qualitätssicherung kann nicht eine Rangliste der Kliniken sein, sondern flächendeckend hervorragende Qualität. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die im Rahmen der Qualitätssicherung erhobenen Daten von einem Laienpublikum korrekt interpretiert werden können?
Strafe als falsches Instrument
Ein hochqualifiziertes wissenschaftliches Institut erstellte kürzlich in Nordbayern eine Rangliste der Geburtskliniken auf Basis der publizierten Daten der Qualitätssicherung. Danach war die beste Geburtsklinik eine Belegabteilung mit 300 Geburten. Ist es ein Wunder, dass sich eine Patientin beim Chef eines Perinatalzentrums beschwerte, warum sie jetzt aus dem besten in ein nachgewiesenermaßen schlechteres Krankenhaus verlegt wurde?
Und schließlich sollen nach dem aktuellen Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung die Ergebnisse der Qualitätssicherung auch für die Krankenhausplanung genutzt werden. Sie sollen Häuser identifizieren, denen Kürzungen ihrer Entgelte drohen. Außerdem sollen Häuser oder Abteilungen mit, wie es im SGB V heißt, einer „nicht nur vorübergehend in einem erheblichen Maß unzureichenden Qualität“ geschlossen werden. Unter dem Aspekt der Strafe mag es ja sinnvoll sein, schlechte Leistung mit weniger Geld zu sanktionieren. Aber ist Strafe hier das richtige Instrument? Wird beispielsweise ein Krankenhaus auf dem Lande bei schlechter Qualität dann geschlossen? Verbessert es die Qualität der medizinischen Versorgung der dort ansässigen Bevölkerung, wenn sie kein Krankenhaus mehr haben?
Wäre es nicht Aufgabe einer vernünftigen Krankenhausplanung zu überlegen, welches Krankenhaus mit welchen Abteilungen wo nötig ist und es dann so mit Personal und Technik auszustatten, dass gute Qualität möglich ist? Flächendeckend gute Qualität – das war einmal das Ziel.
Wie soll mit weniger Geld mangelhafte Qualität gebessert werden? Erfahrungsgemäß kostet es eher mehr Geld, schlechte Strukturen und mangelhafte Technik zu verbessern als weniger. Schon heute ist es zunehmend schwieriger, qualifizierte Ärzte zu finden. Selbst Universitätskliniken in Großstädten beklagen bereits einen Mangel an qualifizierten Oberärzten. Wie sieht es da in ländlichen Regionen aus?
Es steht zu befürchten, dass es nicht lange dauern wird, bis sie entscheidende Voraussetzung für gute Qualität die ausreichende Ausstattung mit Ärzten ist. Dann werden wohl nicht Sanktionen Abteilungen schließen, sondern die Unmöglichkeit, ausreichend Personal vorzuhalten. Für Ärzte und Pflegepersonal ist aber Freude und Erfüllung bei der Arbeit und nicht zuletzt mehr Kontakt mit Patienten als mit Computern der entscheidende Grund, um in einem Krankenhaus zu arbeiten. Gute Qualität zu liefern ist auch heute eine hohe Motivation für Ärztinnen, Ärzte, Schwestern und Pfleger.
Anfang dieses Jahrtausends gab es erneut Aufruhr in der deutschen Presse und Öffentlichkeit: Die Qualität bei der Behandlung von Brustkrebspatientinnen in Deutschland sei im internationalen Vergleich schlecht.
Erneut reagierten die deutschen Frauenärzte und Kollegen anderer Fachgebiete revolutionär. Sie führten die Zertifizierung von Brustkrebszentren ein. Außer in NRW geschah dies freiwillig und ohne staatliche Vorgaben. Die Kliniken unterwarfen sich strengen strukturellen und personellen Anforderungen, änderten radikal die Art, wie Ärzte und Abteilungen unterschiedlicher Fachrichtungen in Klinik und Praxis zusammenarbeiten.
Strenger als der Gesetzgeber
Die Zentren investierten Geld in Konferenzen und Dokumentationssysteme und verpflichteten sich, nicht nur die Struktur-, sondern auch die Ergebnisqualität prüfen zu lassen, also das Schicksal ihrer Patientinnen über viele Jahre zu erfassen und zu dokumentieren. Sie unterwerfen sich jährlichen Prüfungen und Datenvalidierungen durch ein von der Deutschen Krebsgesellschaft geschaffenes Institut, genannt Onkozert, die viel strenger und intensiver sind als diejenigen der gesetzlichen Qualitätssicherung und vor Ort stattfinden.
Fast 300 Kliniken in Deutschland unterzogen sich diesem Verfahren und haben Brustzentren zertifizieren lassen. Diese versorgen über 80 % aller Brustkrebspatientinnen. Dieser Zusatzaufwand wird bis heute nicht adäquat finanziert. Dennoch wurde das System weiter ausgebaut. Darmzentren, Gynäkologische Krebszentren, Prostatakrebszentren, Viszeralkrebszentren, Hautkrebszentren und so weiter wurden geschaffen und schließlich als Dach des Ganzen Onkologische Zentren. Die Qualitätssicherung und -verbesserung ist vitaler denn je, die Ärzteschaft praktiziert sie weiter freiwillig und aus Überzeugung.
Prof. Dr. Anton Scharl1,
unter Mitarbeit von Prof. Dr. Dietrich Berg2
1Chefarzt der Frauenklinik, Klinikum St. Marien, 92224 Amberg , 1. Vizepräsident der DGGG
2Ehemaliger Chefarzt der Frauenklinik, Klinikum St. Marien, 92224 Amberg, ehemaliger Präsident der DGGG

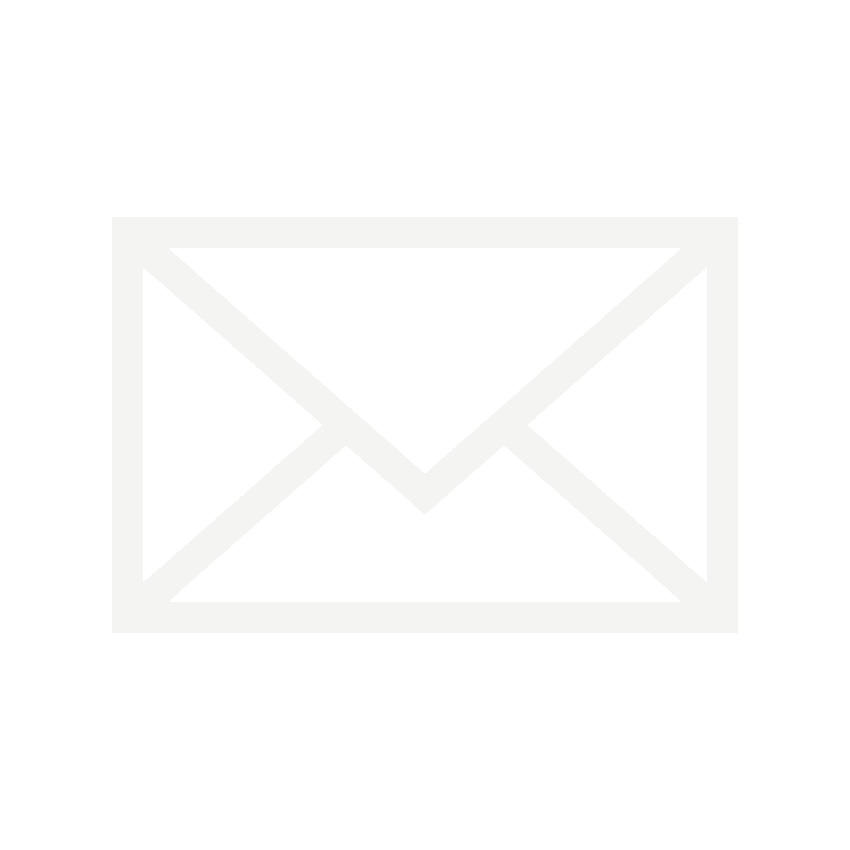


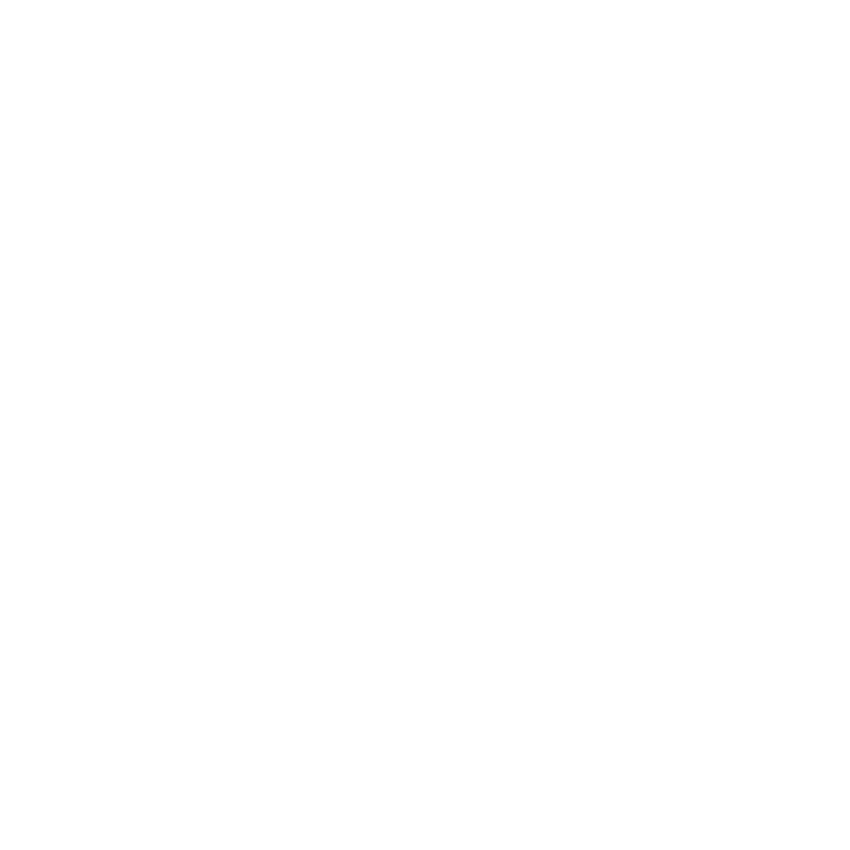
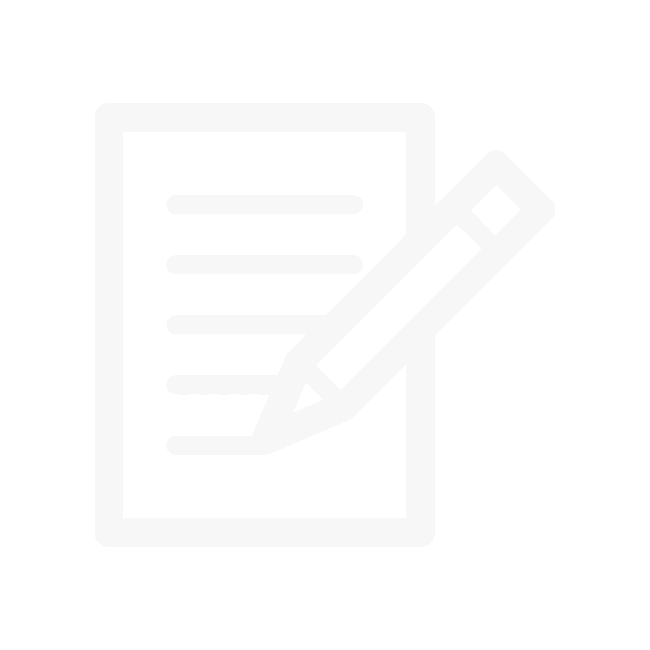


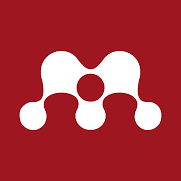


Möwius, Bernd